Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Wäsche reinigen zu lassen, schwitze ich das, was ich am Leibe trage durch und durch. Und dann sagt die Dame in der Annahmestelle, sie könnten nur noch Aufträge annehmen, bei denen sie zwei Tage Zeit zur Erledigung haben. Da ist wohl der Trockner defekt. „Too late“, sage ich, da die Reise morgen schon weiter gehen soll. Sie antwortet, dass es weiter hinten im Ort noch eine Wäscherei gebe. Also weiter.
Es kommen uns jede Menge Motorräder entgegen, die einen Seitenwagen anmontiert und einen Überbau über das gesamte Gefährt haben. So sehen hier die sogenannten Trishaws aus, mit denen ein guter Teil der Transporte auf den Inseln erfolgt.
Die Straße ist staubig. Und natürlich heiß.
Geschlossen. Die Ausweichwäscherei ist geschlossen. Also dann halt nicht. In der nächsten Unterkunft, so stand es in der Buchungsbestätigung, gibt es auch die Möglichkeit, waschen zu lassen.
Er brach leider unter diesem Gewicht zusammen, konnte ihm nicht standhalten.
Ich schnappe mir Schnorchel, Maske und meine Kamera und schaue, was im Wasser geboten wird. Es geht ewig weit sehr flach hinaus, sicher hundert Meter. Sehr bald, nach ca. fünf Metern, wächst Seegras, in dem sich viele Seeigel verstecken. Aber auch Seesterne. Das Wasser ist trübe und doch bekomme ich gleich ein Tänzchen von zwei Clownfischen geboten, die tapfer ihre Anemone verteidigen.
Den einen oder anderen von mir bislang noch nie gesichteten Fisch bekomme ich zu sehen, auch ein paar dieser bunten Pfeifenputzer, die sich schnell in ihr Gehäuse zurückziehen, wenn man sich ihnen zu sehr nähert. Ich schnorchle einige Zeit und kehre dann zurück an den Strand.
Oben ohne ist hier eigentlich nicht. Aber die beiden posen und die einheimischen Männer hinter uns lachen. Eine Gruppe schmerbäuchiger Europäer spaziert vorbei und bleibt ohne Regung.
Die Show ist vorbei. Kein ernsthafter Interessent hat auf die Damen reagiert. Keiner ging ins Netz. Dann halt vielleicht morgen…


 unser Frühstück verzichten und um 6 Uhr zum Hafen aufbrechen. Nach 25 Minuten waren wir da – nix eine Stunde, wie uns prophezeit worden war. So waren wir also zweieinhalb Stunden vor Ablegen unseres „John Paul II.“ am Pier. Und erlebten dann eine philippinische Version des Traumschiffs. Denn wir haben ja einen „State Room“ und damit erste Klasse gebucht. Eine sehr gute Entscheidung, wie sich noch rausstellt.
unser Frühstück verzichten und um 6 Uhr zum Hafen aufbrechen. Nach 25 Minuten waren wir da – nix eine Stunde, wie uns prophezeit worden war. So waren wir also zweieinhalb Stunden vor Ablegen unseres „John Paul II.“ am Pier. Und erlebten dann eine philippinische Version des Traumschiffs. Denn wir haben ja einen „State Room“ und damit erste Klasse gebucht. Eine sehr gute Entscheidung, wie sich noch rausstellt. orraum mit – ja, wie soll man das nennen? Chaiselongue? Designverbrechen? Jedenfalls kann man den Rucksack ganz passabel drauf ablegen. Im Hauptraum ein Doppelbett mit direktem Blick hinaus aufs Meer und ein Einzelbett, darauf zum Schwan geformte Handtücher. Alles sauber, auch das kleine Badezimmer, aber man sieht, dass hier schon viele Filipinos die Überfahrt nach Cebu gewagt haben. Wir erkunden zunächst das Schiff und geraten in den großen Ess- und Entertainmentsaal. Und da geht’s schon los: Karaoke! Kaum jemand sitzt im Saal, aber zwei einsame Sänger trällern schon ins Mikrofon. Das wird sich den ganzen Tag auch nicht ändern. Offensichtlich ganz normal hier, ob man jetzt singen kann oder nicht (die Dame gerade kann es definitiv nicht), ob in der Gruppe oder allein, man setzt sich hin, singt los und beschallt damit den gesamten Raum. Dahinter befindet sich das Sonnendeck, die einzigen Sitzgelegenheiten hier sind den Rauchern vorbehalten. Wir blicken auf den Hafen
orraum mit – ja, wie soll man das nennen? Chaiselongue? Designverbrechen? Jedenfalls kann man den Rucksack ganz passabel drauf ablegen. Im Hauptraum ein Doppelbett mit direktem Blick hinaus aufs Meer und ein Einzelbett, darauf zum Schwan geformte Handtücher. Alles sauber, auch das kleine Badezimmer, aber man sieht, dass hier schon viele Filipinos die Überfahrt nach Cebu gewagt haben. Wir erkunden zunächst das Schiff und geraten in den großen Ess- und Entertainmentsaal. Und da geht’s schon los: Karaoke! Kaum jemand sitzt im Saal, aber zwei einsame Sänger trällern schon ins Mikrofon. Das wird sich den ganzen Tag auch nicht ändern. Offensichtlich ganz normal hier, ob man jetzt singen kann oder nicht (die Dame gerade kann es definitiv nicht), ob in der Gruppe oder allein, man setzt sich hin, singt los und beschallt damit den gesamten Raum. Dahinter befindet sich das Sonnendeck, die einzigen Sitzgelegenheiten hier sind den Rauchern vorbehalten. Wir blicken auf den Hafen 

 serviert, dann kommt der kalte Fisch – hätten wir am Abend zuvor nicht ein hervorragendes
serviert, dann kommt der kalte Fisch – hätten wir am Abend zuvor nicht ein hervorragendes




 nfalls vom Verkehr extrem gebeutelte Jakarta, Delhi und Kalkutta mit großen Gegensätzen zwischen Arm und Reich, Phnom Penh , wo wir uns in der Dunkelheit in zwielichtigen Vierteln verirrten, Kuala Lumpur im Schatten der indonesischen Brandrodung, aber Manila scheint noch verpesteter, noch dreckiger, noch zwielichtiger und noch gegensätzlicher zu sein. Der Gestank von Kloaken oder Urin nimmt einem an manchen Ecken den Atem, der sowieso schon äußerst flach ist, weil wir die Autoabgase nicht allzu tief in unsere seit über 90 Tagen rauchfreien Lungen hineinlassen wollen. An einer riesigen Straße, auf der der Verkehr vorbei donnert, haben sich Menschen auf Zeitungen ihr Nachtlager gebaut. Auch in Indien leben viele Menschen auf der Straße, aber man hat das Gefühl, sie suchen sich wenigstens einen Hauseingang in einer Nebenstraße.
nfalls vom Verkehr extrem gebeutelte Jakarta, Delhi und Kalkutta mit großen Gegensätzen zwischen Arm und Reich, Phnom Penh , wo wir uns in der Dunkelheit in zwielichtigen Vierteln verirrten, Kuala Lumpur im Schatten der indonesischen Brandrodung, aber Manila scheint noch verpesteter, noch dreckiger, noch zwielichtiger und noch gegensätzlicher zu sein. Der Gestank von Kloaken oder Urin nimmt einem an manchen Ecken den Atem, der sowieso schon äußerst flach ist, weil wir die Autoabgase nicht allzu tief in unsere seit über 90 Tagen rauchfreien Lungen hineinlassen wollen. An einer riesigen Straße, auf der der Verkehr vorbei donnert, haben sich Menschen auf Zeitungen ihr Nachtlager gebaut. Auch in Indien leben viele Menschen auf der Straße, aber man hat das Gefühl, sie suchen sich wenigstens einen Hauseingang in einer Nebenstraße.
 durch die riesige Mall, um uns herum dudeln Jingle Bells und Rudolph the red nosed reindeer,
durch die riesige Mall, um uns herum dudeln Jingle Bells und Rudolph the red nosed reindeer,





























































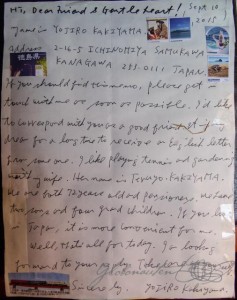

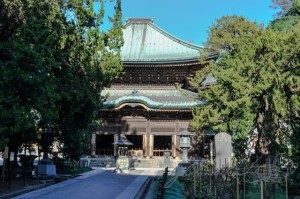












 wie er es uns präsentiert – ist nur ein paar Kilometer weg. Zuerst geht es über schwarzwaldähnliche Hügel und dann liegt es vor uns: wild und wunderbar blau. Ein paar Fischerdörfer, die Strände menschenleer, zerklüftete Buchten und kleine Inseln.
wie er es uns präsentiert – ist nur ein paar Kilometer weg. Zuerst geht es über schwarzwaldähnliche Hügel und dann liegt es vor uns: wild und wunderbar blau. Ein paar Fischerdörfer, die Strände menschenleer, zerklüftete Buchten und kleine Inseln.








 Bagger auf. Und innerhalb von zehn Minuten ist die Baustelle nicht nur eingerichtet, sondern es wird bereits der Asphalt aufgerissen.
Bagger auf. Und innerhalb von zehn Minuten ist die Baustelle nicht nur eingerichtet, sondern es wird bereits der Asphalt aufgerissen.